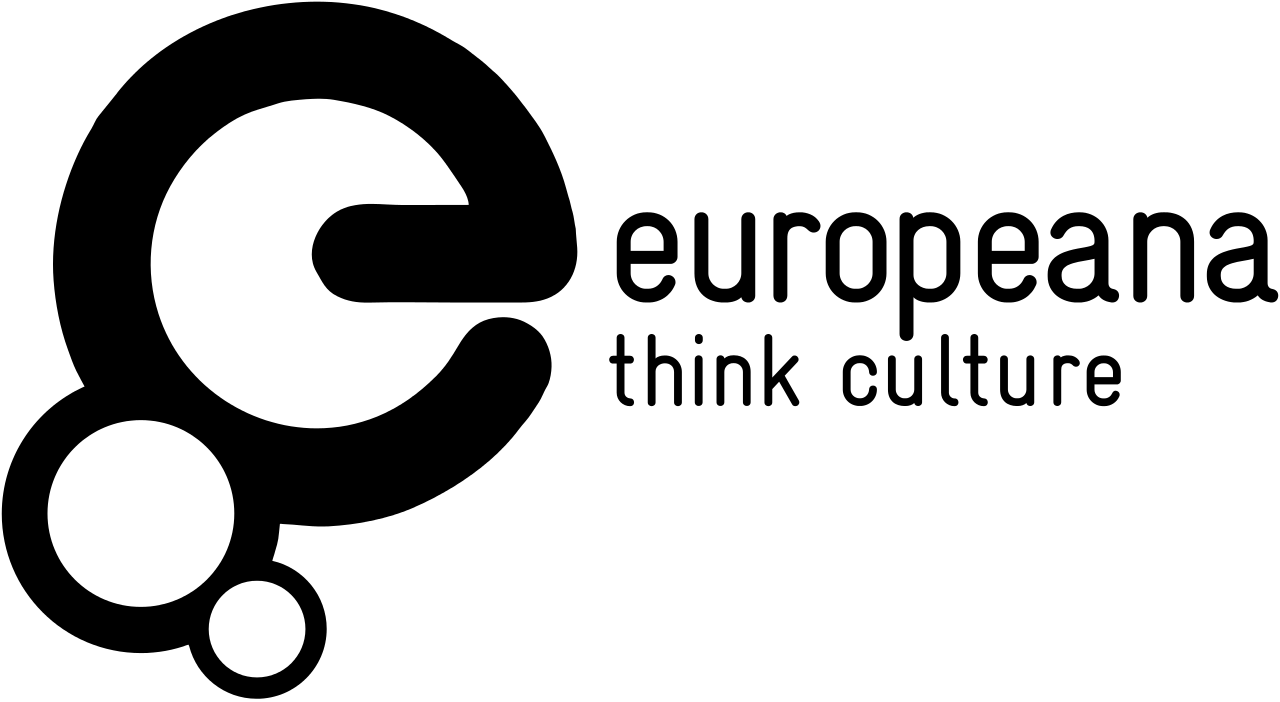Vorlesungsreihe ›Digital Transformation‹
Ein Lehrstück ohne Lehre
Was uns in der heutigen Zeit zu interessieren hat, sind nicht die Ergebnisse von Veränderungsprozessen, es sind die Veränderungsprozesse selbst. Die ›Digitale Transformation‹ beschreibt nicht den Weg von einer stabilen, ehemals analogen Welt in eine stabile digitale Zukunft — auch wenn diese Suggestion sehr beliebt ist. Viel wichtiger als dieses Ziel erscheint die Geschwindigkeit der Veränderung. Stellen wir uns die Gegenwart in einem definierten zeitlichen Moment als eine bestimmte, exakt umrissene Situation vor. Diese Gegenwart erschiene uns in einer Art Ruhezustand. Auch in jedem anderen Moment können wir diesen Ruhezustand nachweisen. Wir könnten somit schlußfolgern, dass wir uns insgesamt in einem Ruhezustand befinden. Paradoxerweise aber leben wir in einer Welt der dauernden Veränderung, des Wandels und der Entwicklung. In Abwandlung der Heisenbergschen Unschärferelation könnten wir also sagen: Je genauer unsere gegenwärtige Situation bestimmt ist, desto unbestimmter ist ihre Veränderungsgeschwindigkeit. Und andersherum gilt: Je genauer unsere Veränderungsgeschwindigkeit bestimmt ist, desto unbestimmter ist unsere gegenwärtige Lebenswelt. Die Digitale Transformation erscheint uns so monströs, weil sie die Welt (und damit auch unsere Lebenswelt) als ein Modell von ETWAS darstellt. Dieses ETWAS haben wir uns als eine Art kybernetische ›Sozialmaschine‹ vorzustellen, die unsere individuellen Situationen nach ihren Geschwindigkeitsvorstellungen permanent verarbeitet, transcodiert und prozessiert. Die ›Entwicklung der Gesellschaft‹ wird mit der ›Technisierung der Gesellschaft‹ gleichgesetzt und damit die Digitalisierung zum zivilisatorischen Evolutionsschritt umgedeutet. Wir alle perfektionieren also einen zirkulären Veränderungszwang, bei dem jedes Ende gleichzeitig ein neuer Anfang ist.
Die negativen Implikationen der Digitalen Transformation spüren wir noch nicht deutlich genug, weil wir uns selbst noch zu sehr als Manipulateure gefallen. Und hier kommt Design ins Spiel, das in zahllosen ›schöpferischen‹ Akten Lösungen und dazu passende Probleme kartiert und damit die Transformation bewirtschaftet. Für Gestalter*innen werden die Widersprüche ihrer Disziplin erkennbar, sobald sie jenseits der schöpferischen Arbeit mit dem neuen Material auch ökonomische, ökologische oder soziale Rationalitäten berücksichtigen sollen. Spätestens dann wird erkennbar, dass die Disziplin — angesiedelt im argumentativen Niemandsland zwischen ›nachhaltiger Bewahrung‹ und ›disruptiver Veränderung‹ — ihre Argumente je nach Sachlage wählt und kombiniert. Mal sind es ökonomische (Stichwort: ›Kreativindustrie‹), mal ökologische (Stichwort: ›Eco Design‹), mal soziale Gründe (Stichwort: ›Social Design‹) die man nun in Anschlag bringt, um eine Idee zu vermarkten. Der Vernunftzusammenhang wird dabei verschleiert, denn vernünftig ist am Ende doch nur das, was ökonomisch rentiert. So organisieren Teile der Gesellschaft ihre dissonanten Empfindungen über die Frage nach dem richtigen Weg. Wenn die Technik uns keine Grenzen setzt, dann hilft sich der Mensch durch Änderung seines Verhaltens. Es geht in dieser Vorlesung nicht nur um die Stärken und Chancen der digitalen Transformation, es geht immer auch um die Schwächen und Bedrohungen, die vorstellbar und möglich sind und die durch Design sichtbar oder eben häufig auch unsichtbar gemacht werden.
Die Vorlesung behandelt daher politische, kulturelle, wirtschaftliche und ästhetische Fragen der ›digitalen Transformation‹ in einer Art ›Gesamtschau‹.
1 Einführung
2 Systeme Denken
3 Infrastrukturen, Netzwerk, Raum
4 Interactivity
5 Generative Art
6 Analyse und Synthese
7 Synthese und Problemdesign
8 Feedback Machines
9 Arbeit am Mythos
10 Weltmodelle
Seit 2001 arbeite ich kontinuierlich an dieser Vorlesungsreihe. Aus Datenschutzgründen können die Folien nicht öffentlich gemacht werden.